Umbauten im Stile der Zeit
800 Jahre Dorfkirche Wittbrietzen
Detlef Fechner war Jugenddiakon und hat später Kulturgeschichte studiert. Er ist heute Vorsitzender des Gemeindekirchenrats Wittbrietzen und ehrenamtlich als Ortschronist tätig.
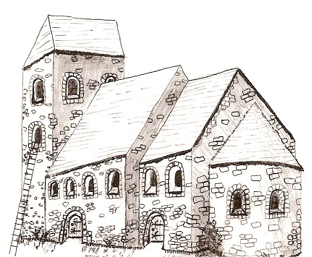
Anmutig und schön steht sie auf dem mandelförmigen Dorfanger von Wittbrietzen. Selbst von denen, die nicht zur Kirchengemeinde gehören, wird sie liebevoll „unsere Kirche“ genannt. So war es eigentlich kein Wunder, dass hier im Ort zwischen 2003 und 2017 für die Komplettsanierung der Kirche fast 50.000 Euro eingeworben werden konnten, durch Sammlungen und durch das Wirken eines Fördervereins. Die besondere Zierde der Kirche und des Dorfes ist zweifelsohne die hölzerne Kirchturmspitze, die grazil und imposant den massigen Turm aus Feldstein krönt. Für Freunde und Liebhaber solch alter Dorfkirchen lassen sich die Veränderungen am Bau über 800 Jahre leicht und deutlich ablesen. So sei Reisenden auf der B2 zwischen Beelitz und Treuenbrietzen ausdrücklich der kleine Schlenker nach Wittbrietzen empfohlen.
Erbaut wurde diese Kirche zwischen 1220 und 1250 aus dem Material, welches massenhaft auf den umliegenden Feldern herumlag: Feldstein.
Die Nachfahren der einstigen Kolonisten lebten inzwischen in dritter Generation hier und sie erbauten sich ihre wohl erste steinerne Kirche im Stil der damaligen Zeit, die wir nun Spätromanik nennen. Die vier typischen Baukörper – halbrunde Apsis, Chorraum, Gemeindehalle und Turm – sind immer noch gut erkennbar. Die ursprüng-lichen Fenster waren klein und hochgelegen: Eines auf der Nordseite und das Mittelfenster der Apsis künden immer noch davon. Die beiden einzigen Türen befanden sich ursprünglich nur auf der Süd- und Sonnenseite der Kirche. Die ehemalige Gemeindepforte ist inzwischen vermauert, der romanische Rundbogen im Mauerwerk noch gut sichtbar. Die Priesterpforte wurde durch den späteren Anbau einer Sakristei überformt. Der gegenüber dem Kirchenschiff leicht eingerückte Turm scheint bauzeitlicher Natur zu sein. Abgeschlossen wurde er ursprünglich durch ein schlichtes Satteldach. Denkbar wäre auch eine spätere Bauzeit des Turms, wie die Inschrift von 1481 auf der einstigen großen Bronzeglocke vermuten lässt. Die offensichtlich gotischen Formziegelsteine an den Fenstern der Glockenstube lassen einen ähnlichen Rückschluss zu.


An der Nordseite der Kirche finden sich bescheidene Putzreste. Laut restauratorischem Gutachten stammen sie aus der Erbauungszeit. Erkennbar sind ebenso noch einige Ritzspuren im Putz, die auf eine Quaderung des Putzes schließen lassen und die die ästhetisch nicht so optimale Vermauerung der Feldsteine kaschieren sollten. Wie zu dieser Zeit allgemein üblich, wurde der Innenraum mit einer Flachdecke abgeschlossen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren Kirchenschiff und Turm räumlich getrennt. Die räumliche Atmosphäre im Innern dürfte somit eine deutlich andere gewesen sein als heute.
Um das Jahr 1450 etablierte sich in dem einstigen Kolonisten- und Bauerndorf Wittbrietzen ein Rittergut, zunächst das derer von Schlieben und von 1523 bis 1684 das derer von Flans. Diesen Patronatsherren lassen sich mindestens zwei bauliche Veränderungen an der Kirche zuordnen. Zunächst den Einbau einer separaten Patronatstür an der Nordseite der Kirche, welche inzwischen schon längst wieder vermauert, im Mauerwerk aber noch gut erkennbar ist. Sodann den Aufsatz einer ersten hölzernen Spitze auf dem Feldsteinturm, vermutlich im 16. Jahrhundert. Diese Erkenntnis war eine große Überraschung, da wir lange davon ausgingen, dass eine Spitze erst mit dem großen Umbau von 1847 auf den Turm kam. Doch eine Miniaturzeichnung aus dem Jahre 1705 belehrte uns eines Besseren. Deutlich erkennbar sind darauf die Turmspitze und die Konturen des einstigen Gutshofes.
Auf das Konto der Patronatsherren von Schlieben geht möglicherweise auch die Ausmalung des Innenraums der Kirche im 15. Jahrhundert. Teile davon konnten bei restauratorischen Untersuchungen in den 2010er Jahren freigelegt und nachgewiesen werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Motive aus dem Kreuzweg-Zyklus. Die Station mit Maria und Johannes unter dem Kreuz – wenn auch nur schwach erhalten – konnten wir komplett freilegen, konservieren und somit für uns Nachgeborene als ein kleines Schaufenster in die Vergangenheit der Kirche erhalten.
Ab dem Jahr 1700 kam es zu den typischen Umbauten im Stile der Zeit.
Das Barock rief nach mehr Licht und so wurden nach und nach fast alle Fenster deutlich vergrößert. Leider wurden die neuen Laibungen nicht immer fachlich solide und mit hochwertigen Ziegelsteinen vermauert. Im Inneren ist vom Einbau eines Kanzelaltars die Rede und 1706 von der Anschaffung eines hängenden Taufengels. Bereits 1726 soll er herabgestürzt sein. Außer den beiden großen Altarleuchtern von 1721 haben alle barocken Ausstattungsstücke spätere Modernisierungen nicht überlebt.
Am Ende des Siebenjährigen Krieges kam es 1763 zur Auflösung des ehemaligen Rittergutes bzw. späteren königlichen Vorwerkes. Durch Friedrich II. wurden 16 Neubauern im Dorf angesiedelt. In der Folge erlebte das Dorf bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein enormes Wachstum seiner Bevölkerung und eine Verdreifachung der Einwohnerschaft. Jahrzehnte langer Streit um fehlende Sitzplätze in der Kirche prägte das Gemeindeleben. Zunächst behalf man sich mit dem Einbau von einfachen, später doppelten Seitenemporen. Die lichte Höhe auf der oberen soll maximal 1,50 m betragen haben. Angesichts des Bevölkerungswachstums erwiesen sich all diese Maßnahmen als unzureichendes Stückwerk und mündeten in dem großen Umbau von 1847. Im Vorfeld wurde sogar ein Abriss und der Neubau einer Kirche mit kreuzförmigem Grundriss erwogen.

Aber es kam – Gott sei Dank – anders. Zur Vergrößerung des Raumes entschloss man sich zu einer in statischer Hinsicht sicher gewagten Variante: der Einbeziehung des Turmraumes in das bis dahin kürzere Kirchenschiff. Dafür musste die 1,40 m breite östliche Wand des Turmes bis in die Höhe von 9 m aufgebrochen werden. Zur gleichzeitigen Erhöhung des Kirchenschiffs wurde die alte Flachdecke entfernt und ein Tonnengewölbe eingebaut. Somit wurde es möglich, im hinteren Bereich der Kirche eine relativ tiefe doppelstöckige Empore zu platzieren. Die ästhetisch eher suboptimalen Seitenemporen konnten dadurch entfallen. Sie sollen sich bis zum Chorraum hingezogen haben und dürften den einstigen romanischen Raumeindruck massiv entstellt haben. Auf der neuen zweiten Empore konnte 1880 die lang ersehnte Orgel aufgestellt werden. Sicher auch aus Platzgründen wurde der Zugang zu den beiden Emporen nach außen verlegt, durch den Anbau eines Seitenturms und den Einbau einer Wendeltreppe. Ebenso wurden die ehemaligen Seiteneingänge verschlossen und der Haupteingang auf die Westseite des Turms verlegt.
Trotz dieser enormen Umbauten konnte die leidige Platzfrage nicht befriedigend gelöst werden. Aber es entstand wieder ein sehr ansprechender sakraler Raum mit einer hervorragenden Akustik. Eine Erneuerung bzw. Vergrößerung der Turmspitze war bei diesem Umbau zunächst nicht vorgesehen. Doch der unermüdliche Pfarrer Dr. Friedrich Liebetrut nutzte offenbar seine guten Verbindungen zum König und Patron Friedrich Wilhelm IV. Mittels einer Zustiftung aus dessen Privatschatulle ließ sich die Spitze mit den beiden sie fassenden Zinnengiebeln doch noch erbauen. Auch alle weiteren Bauelemente aus rotem Backstein gehen weitgehend auf diesen großen Umbau von 1847 zurück. Bei der Einweihung am 7. November 1847 war Friedrich Wilhelm IV. persönlich zugegen.
Bei der großen Komplettsanierung zwischen 2004 und 2017 wurde im Wesentlichen der bauliche Zustand von 1847 konserviert. Lediglich die Schauseite der Empore erhielt ihre Ausmalung vom Anfang des 19. Jahrhunderts zurück, da sie in den 1960er Jahren monochrom überstrichen wurde.

