Eine Kirche als Pilgerzentrum
Schülerprojekt zur Umgestaltung von St. Jacobi in Kreuzberg
Michael G. Gromotka führt als Lehrer am Ev. Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin regelmäßig Unterrichtsprojekte zur Kirchenumgestaltung durch, gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

Wer durch die Kreuzberger Oranienstraße nach Osten Richtung Moritzplatz fährt, den erwartet bei einem Blick nach rechts ein kleines Italien. Plötzlich springt die Blockrandbebauung nämlich nach hinten und gibt den Blick frei auf einen kreuzgangartigen Vorhof, hinter dem sich eine Backsteinbasilika in frühchristlichen Formen und ein freistehender Campanile befinden. Tatsächlich sind Turm und Hof noch jene Bauten, die Friedrich August Stüler entworfen und die Gustav Holtzmann 1844–1845 errichtet hat. Die Kirche selbst war allerdings stark kriegszerstört, im Außenbau aber in den historischen Formen 1954–1857 von Paul und Jürgen Emmerich wiedererrichtet worden.
Wie der heilige Paulus vor San Paolo fuori le Mura in Rom steht im Vorhof eine Statue. Es ist der vom Wiesbadener Emil Alexander Hopfgarten geschaffene heilige Jacobus, der Patron dieser Kirche. St. Jacobi sollte einst eine neue Pfarrkirche für die in diesem Bereich wachsende Luisenstadt werden, deren zahlreiche protestantische Gläubige die mittlerweile zerstörte Petrikirche nicht mehr hätte versorgen können. Inzwischen hat die Luisenstadt ihre Gestalt stark verändert: Viele Gebäude wurden zerstört und in neuen Formen wieder aufgebaut. In der Nachbarschaft wohnen nun überwiegend Menschen muslimischen Glaubens, und die Gemeinde ist stark überaltert. Hinzu kommt, dass die Evangelische Kirchengemeinde allgemein ihre Pfarrstellen reduziert und die Predigtfunktion auf die Kirchen Emmaus-Ölberg und die Melanchthon-Kirche konzentriert.
Es gilt also, eine neue Rolle für St. Jacobi zu finden.
Gerade in dieser Situation hat sich das Patrozinium, das König Friedrich-Wilhelm IV. noch selbst ausgesucht hatte, als zukunftsweisend herausgestellt. Jacobus der Ältere, der Legende nach begraben in Santiago de Compostela, ist nämlich der Pilgerheilige schlechthin, und so wurde in der Kirche am 1. August 2021 ein Pilgerzentrum gegründet. Neben seiner fortbestehenden Pfarrfunktion soll St. Jacobi in Zukunft ein Anlaufpunkt für Pilger sein; ein Ort, an dem sich Menschen über ihre Erfahrungen auf der Pilgerschaft austauschen können, in dem Pilgergottesdienste gefeiert und von dem aus Pilgerschaften unternommen werden können.
Mit Leben gefüllt wird diese Idee vom Pilgerteam und dem Pilgerprediger Thomas Knoll. Im laufenden und im vergangenen Schuljahr hat er je eine zehnte Klasse des Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster eingeladen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Funktion von St. Jacobi als Pilgerkirche stärken könnte, ohne dabei die Pfarrfunktion aufzugeben. Damit wird am Grauen Kloster das Projekt zur Umnutzung von Kirchen fortgesetzt, das ich im Jahr 2021 mit Unterstützung von „denkmal aktiv“, dem Schulprogramm der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, initiiert habe.
Auch in diesem Jahr erhielten die Schüler des Grauen Klosters zunächst wichtige Anregungen von Andreas Roth und Frank Röger, den jeweiligen Leitern der Kirchenbauämter der Katholischen bzw. der Evangelischen Kirche. Dabei lernten sie die große Dimension des Problems von leerfallenden Kirchen in Berlin und Brandenburg kennen und die besonderen Herausforderungen, bei wegfallender Nutzung die Erhaltung der zumeist denkmalgeschützten Bauten zu gewährleisten. Als Stüler-Bau genießt St. Jacobi einen herausragenden Denkmalwert, doch lässt die Tatsache, dass der Innenraum in den fünfziger Jahren stark verändert neu errichtet worden ist, bauliche Eingriffe grundsätzlich legitim erscheinen – zumal, wenn dadurch eine fortdauernde Nutzung des Gebäudes gewährleistet wird und man sich, wie es die Schülerinnen und Schüler getan haben, bei der Planung intensiv mit der Innenraumgeschichte auseinandersetzt.

Pilger, die Schüler und alle anderen Besucher.
Der erste Jahrgang erarbeitete für die teilweise Umnutzung von St. Jacobi fünf verschiedene Entwürfe, die sich in manchen Punkten ähnelten, in anderen aber deutlich unterschieden. Mehrere Entwürfe sahen dabei die Rückkehr von Emporen in den Kircheninnenraum vor. Diese hatten in St. Jacobi bis zur Kriegszerstörung existiert, und viele Schüler äußerten die Ansicht, dass man dem Innenraum deutlich anmerke, dass er eigentlich mit einer Emporenausstattung rechnet; in seiner heutigen Gestalt sei er deutlich zu kahl. Den durch das neue Geschoss gewonnenen zusätzlichen Raum wollten zahlreiche Schülergruppen für ein Pilgercafé nutzen.
Aufwendig entwarfen die Schüler für dessen Ausstattung unterschiedliche Designs mit Muscheln und Kalebassen als auf die Pilgerschaft bezogene Grundmotive.
Die Wände dagegen sollten mit einer Bibliothek ausgestattet werden, die in manchen Projekten eine reine Pilgerbibliothek, in anderen jedoch ein weitergefasstes Angebot darstellen sollte, St. Jacobi zum Lesen, zum Lernen und zum Zweck der Begegnung der Pilger und der Anwohner untereinander aufzusuchen. Zwei Projekte wollten die beiden Emporen in den Seitenschiffen durch eine mittig angebrachte „Brücke des Miteinanders“ (Bibliothecarums-Entwurf) verbinden, die metaphorisch als Ort der Begegnung zu verstehen sei – und zwar auch als Begegnung von Profanem und Sakralem, das insbesondere im unteren Geschoss im Kircheninnenraum weiterhin eine prägende Rolle spielen sollte.

Was macht Sakralarchitektur aus?


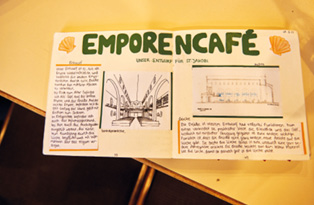
Impulse von Kirchbauamtsleiter Frank Röger und erarbeiteten
einen eigenen Entwurf für die Umgestaltung.
Hier ging es den Schülern vor allem um eine Inszenierung und Nutzbarmachung für die Pilgerschaft. In zwei Entwürfen wurde auf unterschiedliche Weise ein Pilgerweg durch die Kirche vorgezeichnet, der, ähnlich der großen Pilgerschaft, an unterschiedlichen Stationen Halt machen sollte. Im „Stationskirchen-Entwurf“ gibt es hier eine Weltkarte, in der Pilger ihre zurückgelegten Wege eintragen können, einen Ort zum Teilen der Erfahrungen auf Zetteln und eine Station „Ich packe meine Pilgertasche“. Die Vertreterinnen des „Emporencafé-Entwurfs“ sahen dagegen acht Stationen mit Audioguide vor, unter anderem mit Informationen zum heiligen Jacobus, zu den größten Pilgerwegen und zu den Gründen für das Pilgern.
Der „Multikulturelle Entwurf“ trug dagegen der Tatsache Rechnung, dass St. Jacobi heute in einem muslimisch geprägten Viertel liegt. Sie thematisierten, dass auch im Islam und anderen Weltreligionen das Pilgern eine große Rolle spielt und wollten die Kirche etwa mit einem großflächigen Gebetsteppich und der Möglichkeit zum Einbringen von Zetteln mit pilgerbezogenen Bitten in einem mauersichtig freigelegten Pfeiler ähnlich der Klagemauer für alle Weltreligionen öffnen.
Ein anderer Entwurf ging davon aus, dass erst eine ganz ungewöhnliche, aus der Mönchstradition heraus entwickelte Idee St. Jacobi wieder die notwendige Aufmerksamkeit und Attraktivität verschaffen würde: Sie sahen in einem der Pfarrgebäude die Einrichtung einer Brauerei vor, deren Bier im Restaurant in der Kirche als „Pilgerbräu“ serviert werden könne. Dabei sollte St. Jacobi tatsächlich als Übernachtungsstation für durchreisende Pilger dienen.
Die Entwürfe wurden im Dezember in St. Jacobi vorgestellt und werden dort derzeit öffentlich präsentiert. Aktuell arbeitet eine weitere Klasse an Ideen für die Zukunft von St. Jacobi als Pilgerkirche und möchte so einen Beitrag dazu leisten, dass St. Jacobi zukünftig ein Ort für Gemeinschaft sein kann, die durch die Beziehungen der Menschen untereinander lebt.

